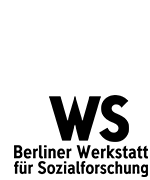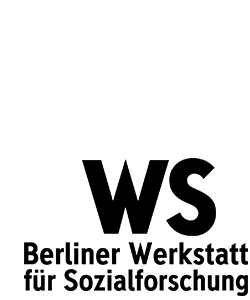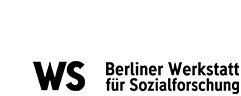Projektteam:
Prof.i.R. Dr. Ernst von Kardorff
Dr. Wolfgang Hien
Dr. des. Kristina Enders
Amy Stelter (stud. Mitarbeiterin)
Antonia Höfs (stud. Mitarbeiterin)
Hintergrund
Aufgrund des demografischen Wandels und des Fachkräftemangels wird es für Unternehmen immer wichtiger, die Arbeitsfähigkeit alternder Belegschaften zu erhalten und gesundheitlicher Prävention und Rehabilitation einen größeren Stellenwert beizumessen; hinzu kommen politische Zielsetzungen wie die Inklusion von Beschäftigten mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen/Behinderungen und eine möglichst weitgehende Vermeidung von Erwerbsminderungsrenten. Während größere KMUs und Großbetriebe diese Herausforderungen zunehmend erkannt haben und mit betrieblicher Gesundheitsförderung (BGF) und betrieblichen Gesundheitsmanagementstrategien (BGM), wie der Motivation zur Inanspruchnahme der Ü-45 Checks präventiv und, bezogen auf die Wiedereingliederung chronisch erkrankter Beschäftigter mit einem eigenen betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) reagieren (können), ist dies bei den meist kleinen Handwerksbetrieben die Ausnahme.
Für Kleinst- und KMU-Betriebe des Handwerks sind längere krankheits- und unfallbedingte Fehlzeiten eine besondere Herausforderung, die erst ansatzweise thematisiert wird. Viele Unternehmen wie auch Beschäftigte im Handwerk tendieren zudem aufgrund arbeitskulturspezifischer Tendenzen zur Verdrängung von Krankheit, Beschäftigte zum Präsentismus und zum Verschweigen gesundheitlicher Beeinträchtigungen. Trotz individueller Ausnahmen scheint in großen Teilen des Handwerks ein „Alles-oder-Nichts“-Prinzip (leistungsfähig = beschäftigt; chronisch krank = keine Weiterbeschäftigung oder Abfindungsregelungen) vorzuherrschen; zudem wird das Thema Krankheit – trotz eines hohen Problemdrucks – oft nur unter der Hand angesprochen, zumeist aber verdrängt oder erst aufgegriffen, wenn „das Kind schon in den Brunnen gefallen ist“. Manche Handwerksbetriebe haben für sich gute Lösungen gefunden, doch diese „models of good practice“ sind oftmals nicht einmal in der gleichen Wirtschafsbranche bekannt und die Bedingungen für eine Übertragung unklar. Mit Blick auf eine gesundheitsbedingt erforderliche Anpassung von Arbeitsbedingungen lassen sich z.B. die Verringerung von Arbeitszeiten oder die Umsetzung auf leidensgerechte Arbeitsplätze oder deren Einrichtung aus betrieblichen Gründen in kleineren Betrieben, wie sie im Handwerk die Regel darstellen, wegen mangelnder Ressourcen und Kenntnisse oder aufgrund der Betriebsabläufe nur sehr schwer und wenn überhaupt nur mit Hilfe von außen (z.B. Integrationsfachdienst; Integrationsamt; Berufsgenossenschaft; Reha-Fachberatung, Firmenservice) realisieren.
Eine Folge dieser knapp skizzierten Situation ist, dass eine (sekundärpräventive) Inanspruchnahme von medizinischen und beruflichen Rehabilitationsleitungen oftmals gar nicht oder zu spät erfolgt. Mit Blick auf die Wiedereingliederung in Arbeit und die nachhaltige Beschäftigungssicherung nach langer krankheitsbedingter Abwesenheit zeigt sich, dass z.B. formale BEM-Verfahren im Handwerk nur selten durchgeführt werden und eine gelingende Rückkehr in Arbeit stark vom Engagement einzelner Betriebsinhaber:innen abhängt. Informationen zu Reha-Angeboten sind oft nicht bekannt oder die Beantragung von Hilfen erscheint zu bürokratisch. Institutionell verankerte und spezifisch auf die Belange des Handwerks zugeschnittene Unterstützungsmöglichkeiten für Kleinst- und Kleinbetriebe fehlen fast vollständig, die Einbindung in entsprechende Netzwerke oder institutionalisierte Kontakte zu Beratungsstellen und Klinikambulanzen sind bislang die Ausnahme. Diese unbefriedigende Situation sowohl beim Zugang zu medizinischer und beruflicher Rehabilitation als auch beim Management der Wiedereingliederung und einer nachhaltigen Beschäftigungssicherung nach langen Zeiten der Behandlung und Rehabilitation bildet den Ausgangspunkt unseres Forschungsvorhabens.
An dessen Beginn steht eine Feststellung einschlägiger Unterstützungsbedarfe für Handwerksbetriebe und der Reha-Bedarfe ihrer Beschäftigten. Dabei stehen die konkreten Erfahrungen und Einschätzungen der Beteiligten bei der Erhebung im Vordergrund, ergänzt durch die Perspektiven der jeweiligen institutionellen Interessenvertretungen (Handwerkskammer und Innungen; Arbeiterkammer, Gewerkschaften), institutionelle Kooperationspartner (Renten- und Unfallversicherung, Inklusionsamt) und von Experten:innen (Betriebsärzte, Reha-Kliniken, Reha-Fachberatung, Integrationsfachdienste, usw.).
Inzwischen gibt es einige wenige Beispiele guter Praxis wie die schon vor Jahrzehnten vom Hamburger Senat finanzierte Beratungsstelle „Arbeit & Gesundheit e.V.“ (www.arbeitundgesundheit.de) oder das regional gut vernetzte Projekt esa e.V. in Schleswig (www.esa-sh.de), das allerdings noch wenig bekannt und in seiner Übertragbarkeit begrenzt ist oder auch die Peer-Beratung verunfallter Beschäftigter durch die Berufsgenossenschaften (z.B. www.bgbau.de), die sich auf ein bestimmtes Handlungsfeld beschränken.
Einige vielversprechende Ansätze lassen sich auch im Umfeld der seit 2019 in der Praxis aktiven Bundesmodellförderung des Reha-Pro-Programms entdecken: wie etwa die Beratungs- und Vermittlungsangebote „Blaufeuer“ für Arbeitnehmer:innen mit psychischen Problemen oder der von der DRV Oldenburg-Bremen ebenfalls für Menschen mit psychischen Störungen und/oder Suchtproblemen entwickelte „Rehakompass“ oder das von der Deutsche Rentenversicherung Braunschweig-Hannover initiierte Projekt „BEM-intensiv“, das ein professionelles betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) direkt in die bislang unterversorgten kleinen und mittlere Betriebe bringt. Um nur einige zu nennen.
Die bisherigen Erfahrungen aus diesen vielfältigen Vorhaben sollen in unsere Studie einbezogen werden. In unseren Erhebungen widmen wir uns exemplarisch der bislang in Forschung und Praxis kaum berücksichtigten speziellen Situation im Handwerk und den dort zu ermittelnden Unterstützungsbedarfen.
Wissenschaftliche und praxisbezogene Ziele
Der erwartete Erkenntnisgewinn des Projekts besteht in einem vertieften Wissen der Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarfe und der Bedingungen ihrer Akzeptanz bei Kleinst- und Kleinbetrieben und ihrer Beschäftigten im Falle von langandauernden krankheitsbedingten Fehlzeiten, bei gesundheitsbedingter Leistungsminderung und nach Rückkehr in Arbeit nach Rehabilitationsmaßnahmen. Dies wird exemplarisch am Beispiel Bremer Handwerksbetriebe untersucht, wobei Bedingungen für eine Übertragbarkeit auf andere Regionen und auf andere Kleinst- und Kleinbetriebe außerhalb des Handwerks benannt werden sollen.
Ein besonderes Augenmerk richtet sich dabei präventiv auf verbesserte Möglichkeiten zur rechtzeitigen Inanspruchnahme von medizinischer Rehabilitation oder von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sowie auf erforderliche und Hilfen für Betriebe und ihre Mitarbeiter:innen bei der (Wieder-)Eingliederung in Arbeit unter Bedingungen bedingter Gesundheit. Praxisbezogen werden auf die spezifischen ermittelten Bedarfe abgestimmte Informationsmaterialien und Handreichungen entwickelt, die in einem partizipativen Prozess so gestaltet werden, dass sie von Handwerksbetrieben nicht nur akzeptiert, sondern auch genutzt werden können. Parallel dazu sollen für die Gesundheitsdienstleister in der Rehabilitation Informationen bereitgestellt werden, die ein Verständnis für die spezifischen Belange von Kleinbetrieben des Handwerks vermitteln und entsprechende „Do´s and Dont´s“ enthalten. Mit Blick auf die Überwindung von Schnittstellen werden Empfehlungen für niedrigschwellig aufzubauende und zu verstetigende Infrastrukturen zur routineförmigen Unterstützung von Kleinst- und Kleinbetrieben im Handwerk für die Information und Beratung im Kontext von chronischen/chronifizierten Krankheiten entwickelt.
Aktuelles
Gemeinsam mit der Rentenversicherung Oldenburg-Bremen planen wir eine Tagung. Die Veranstaltung soll dazu dienen, die zentralen Prozessbeteiligten im Feld, die wir bereits identifizieren konnten, in einen Dialog zu bringen.
Die Fachtagung findet am 20.Juni 2024 ab 14 Uhr in den Räumlichkeiten der DRV Oldenburg-Bremen (Schwachhauser Heerstraße 32-34 28209 Bremen) statt. Interessierte sind herzlich eingeladen.
Um eine Anmeldung wird gebeten: rehand@bws-institut.de
Weitere Informationen zum Programmablauf folgen in Kürze.
Ansprechpartner: Prof. i.R. Dr. Ernst von Kardorff; E-Mail: kardorff@bws-institut.de